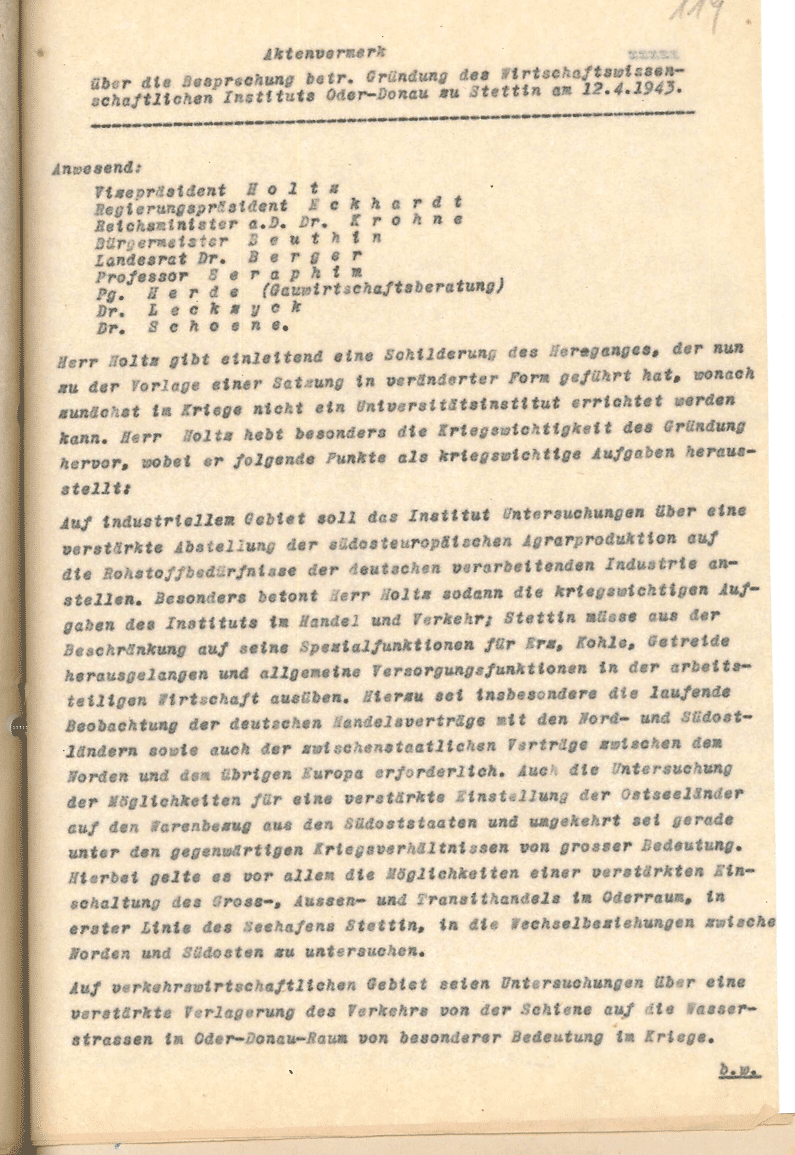Das Oder-Donau-Institut gliederte sich in drei Hauptreferate: das Hauptreferat I Südosten mit den Länderreferaten Slowakei-Ungarn, Kroatien-Serbien-Griechenland, Bulgarien-Türkei und Rumänien; das Hauptreferat II Osten mit den Länderreferaten Ostdeutschland, ehemaliger baltischer-polnischer-russischer Raum, Protektorat Böhmen und Mähren, Weißrussland, Hauptreferat III Ostseeraum mit den Länderreferaten Dänemark-Norwegen, Schweden und Finnland.
Inhaltlich widmete sich das Institut fünf Arbeitsfeldern. Die Frage der Steigerung von Anbauflächen und Bodenerträgen insbesondere mit Blick auf Rumänien und die Ukraine im Sinne der Kriegsernährungswirtschaft spielte dabei ebenso eine Rolle wie industriewirtschaftliche Analysen und Ressourcenforschung, etwa zur Erschließung von Erdölvorkommen in Rumänien und Bulgarien. Auf finanzwirtschaftlichem Gebiet wurden Markt- und Absatzfragen in Südosteuropa und Nordeuropa analysiert. Besondere Aufmerksamkeit widmete das Institut der Untersuchung verkehrswirtschaftlicher und verkehrstechnischer Probleme. Ein besonderes Arbeitsgebiet war die Bevölkerungsforschung, die der Erschließung von Arbeitskräftereserven für die deutsche Kriegswirtschaft in den okkupierten Gebieten dienen sollte.